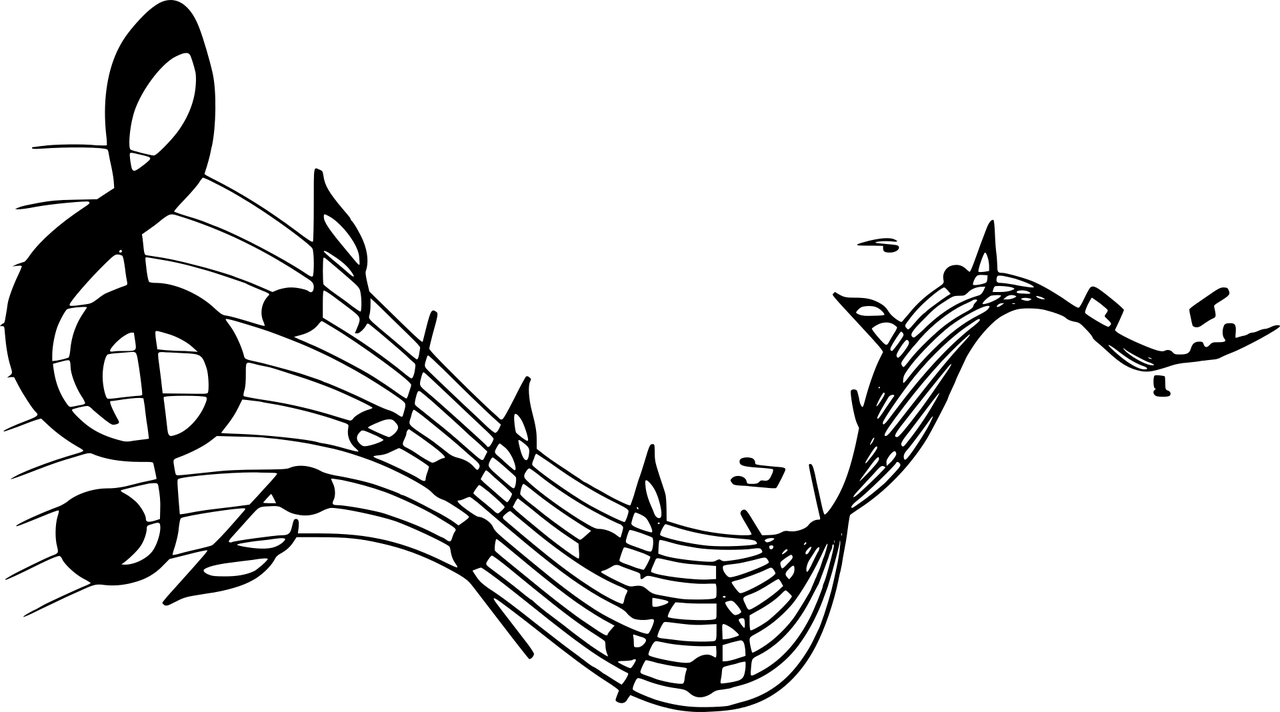1905, von Dr. B. Donath. Ein geheimnisvoller Zauber, ein merkwürdiger Reiz, dem wir uns nicht entziehen können, umgibt die Schallphänomene.
Andere Erscheinungsformen mögen mit gewaltigeren Effekten auf uns einwirken, so namentlich die Aeußerungen der elektrischen Kräfte; um die akustischen Wahrnehmungen bleibt es trotzdem etwas ganz Eigenes, namentlich für den Laien, und weil die Einbildungskraft dort einsetzen kann, wo die direkte Wahrnehmung nicht voll befriedigt. Flüstergalerien und Flüsterbänke, der verstärkte Widerhall stiller Gewölbe, der leise Aufschlag des Steinchens im tiefen Brunnen, Donner und Echo sind fast alltägliche Erscheinungen und doch von stets erneuter Wirkung auf unsere Sinne.
Dies ist ein historischer Text, welcher nicht geändert wurde, um seine Authentizität nicht zu gefährden. Bitte beachten Sie, dass z. B. technische, wissenschaftliche oder juristische Aussagen überholt sein können. Farbige Bilder sind i. d. R. Beispielbilder oder nachcolorierte Bilder, welche ursprünglich in schwarz/weiß vorlagen. Bei diesen Bildern kann nicht von einer historisch korrekten Farbechtheit ausgegangen werden. Darüber hinaus gibt der Artikel die Sprache seiner Zeit wieder, unabhängig davon, ob diese heute als politisch oder inhaltlich korrekt eingestuft würde. Lokalgeschichte.de gibt die Texte (zu denen i. d. R. auch die Bildunterschriften gehören) unverändert wieder. Das bedeutet jedoch nicht, dass die darin erklärten Aussagen oder Ausdruckweisen von Lokalgeschichte.de inhaltlich geteilt werden.
Gehen wir dieser gewiß auffälligen Erscheinung nach, so bietet sich immer wieder die gleiche Lösung des Rätsels. Wenn der Dichter vom Sturmwind sagt, man wisse nicht, von wannen er kommt und braust, so gilt dies in erhöhtem Maß von den Schallwellen. So sonderbar es klingen mag, wir sind zur Bestimmung der Schallrichtung wirklich so gut wie unfähig und würden uns ohne Beihilfe des Auges und ohne einen reichen Schatz vieljähriger Erfahrungen in der akustischen Welt kaum auskennen. Wie oft führt uns nicht irgendein unerklärliches Geräusch, ein leises Klirren oder Pochen in der Wohnung umher. Ein mutwilliger Geist lockt uns zum Fenster, dann zur Ofentür, von der Ofentür zum Bücherbrett, zum Gläserspind, von den Nippes zur Lampenglocke, meist ohne daß es uns gelänge, des Störenfrieds habhaft zu werden. Schließlich sind wir erschreckt, ihn dort zu finden, wo wir ihn niemals vermutet hätten. Theaterglocken, deren verklärter Ton aus höchsten Höhen zu uns herabzuschweben scheint, fristen ihr verstaubtes Dasein oft im Bühnenkeller, und die Theaterorgel steht sicher nicht dort, wo das Ohr sie hört und der gefesselte Blick sie gemalt sieht.
Ein Heer von Erfindern ist geschäftig gewesen, der mangelnden Orientierungsgabe des Ohrs nachzuhelfen, aber fast ohne allen Erfolg. Wichtig genug, ja vielleicht von unabsehbarer Tragweite wäre die Lösung des Problems. Denn in ungezählten Fällen waren und sind beispielsweise Schiffe an der unsicheren Wahrnehmung akustischer Signale zugrunde gegangen, und wenn irgendetwas die warnende Antwort der Nebelsirene spukhaft und nervenzerrüttend macht, so ist es die Sicherheit, einer drohenden Gefahr gegenüberzustehen und nicht zu wissen, wo sie sich befindet.
Je mehr man sich in die bisher geübte akustische Signalgebung auf See und an der Küste vertieft, desto problematischer muß sie in vielen Fällen erscheinen, und zwar nicht nur aus den schon angeführten Gründen.
Könnten wir akustisch sehen, so würden wir auf den ersten Blick wahrnehmen, ein wie ungünstiges Medium die Luft für jede sichere Schallübertragung ist, bald durchlässig, bald undurchlässig, voller Schlieren, Trübungen und launischen Gewölk – akustischem Gewölk natürlich. Homogenität, d. h. überall gleiche Dichte, ist aber das erste Erfordernis einer sicheren Uebertragung.
Ein glücklicher Zufall will, daß sie gerade bei nebligem Wetter meist vorhanden ist. Sonst stände es wirklich schlimm. Früher glaubte man, der optisch klaren Luft auch die akustisch größte Durchlässigkeit zusprechen zu müssen. Das war ein Irrtum. Wer zu beobachten versteht und, etwa am sommerlichen Seestrande, seine Erholung mit einer reizvollen und anmutigen Art der Naturbetrachtung verbindet, kann gerade, wenn die klare Luft sonniger Tage ferne Küstenstriche zum Greifen nahebringt, ein wahres Tohuwabohu akustischer Mannigfaltigkeiten beobachten. Vertikale Luftschichten verschiedener Temperatur und daher verschiedener Dichtigkeit, mögen sie optisch auch noch so durchsichtig sein, wirken stets als Schallspiegel, und zwar werfen sie die akustischen Wellen nach bekannten Gesetzen zurück und auseinander. Für den Beobachter hinter den Schichten ist dann eine Trübung vorhanden, die oft, ohne daß das Auge auch nur die Spur einer Veränderung wahrnimmt, auftaucht oder herbeizieht. Plötzlich ist der Schallschatten da, und die Signalpfeifen der Dampfer oder die schweren Marinegeschütze der Hafenbefestigung erklingen verlöschend wie aus weiter, weiter Ferne, kaum wahrnehmbar, bis sie plötzlich in voller Klarheit und in „greifbarer“ Nähe – sit venia verbo – erscheinen. Dann ist die akustische Wolke vorüber. Nicht immer sind die Trübungen stark genug, um mit dem wechselnden Wolkenspiel vor der Sonne verglichen zu werden, aber voll akustischer Schlieren ist die optisch klare Luft fast stets.
Dazu kommt verwirrend noch eine andere Erscheinung, die so recht ein Spiel der Schallwellen selbst ist und eine Analogie auf optischem Gebiet in dem überaus reizvollen Phänomen der durch Interferenz entstehenden Scheinfarben besitzt. Entfernt sich ein Schiff von einer Schallquelle, sagen wir einer Nebelhornstation, so durchfährt es wunderlicherweise oft eine mehr oder minder ausgesprochene Reihe von schallstarken und schallschwachen Fonen, deren Existenz zuerst von General Duane bei den Nebelsignalen von Maine in den Vereinigten Staaten nachgewiesen wurde. Eine merkwürdige Beobachtung in der Tat, da jede plausible Erklärung an dem objektiven Tatbestand abzuprallen scheint. Daß die Schallstärke mit der Entfernung abnimmt, versteht man ohne weiteres, auch wohl das Gesetz der Abnahme, wie aber kann die Schallstärke wieder zunehmen, dann wieder ab, wieder zu und so fort, bis der wachsende Abstand von der Schallquelle die Gehörsempfindung erlöschen lässt?
Erst die wissenschaftliche Forschung mit ihren subtilen Vorstellungen von der Ausbreitung der Schwingungsbewegungen in einem elastischen Medium, wie es die Luft ist, von den Beziehungen zwischen Tonhöhe und Schwingungszahl eines klanggebenden Körpers, mit ihrer lebhaften Anschauung von der Entstehung und dem mechanischen Bau einer Schallwelle hat uns die Lösung des anscheinend unentwirrbaren Rätsels gebracht. Schallwellen gelangen in unserm Fall nicht nur auf einem, sondern auf zwei Wegen zum Ohr, einmal direkt auf geradem Weg und zweitens durch Reflexion an der Meeresfläche. Zwar schickt die Schallquelle alle Verdichtungen und Verdünnungen, aus denen die Schallwolle besteht, gleichzeitig auf den Weg, aber sie kommen nur dann zugleich beim Ohr an, wenn das Mehr des Umwegs über die reflektierende Fläche gerade eine volle Wellenlänge oder das Vielfache davon gegen den geraden Weg beträgt. In allen andern – natürlich dazwischenliegenden – Fällen kommen Verdichtungen auf dem einen und Verdünnungen auf dem andern Weg gleichzeitig an, und das Resultat ist Bewegungslosigkeit, Ruhe Schallfreiheit. So bildet sich durch Zusammenwirken zweier fortlaufender Wellenzüge ein festes System stehender Wellen mit schallstarken und schallschwachen Zonen aus, mit Bezirken, in denen man etwas hört, und solchen, in denen man nichts hört.
Das alles mag sinnverwirrend sein, aber es ist doch überaus einfach gegen den akustischen Befund in allseitig geschlossenen Räumen. Hier werden alle Berechnung und alle Voraussage an der ins Ungemessene gesteigerten Mannigfaltigkeit zuschanden.
Wir haben in jüngster Zeit so oft Veranlassung gehabt, die Akustik neuer Gebäude zu diskutieren, zuletzt bei unserm Berliner Dom, daß ein abermaliges Zurück auf den Gegenstand im speziellen unterbleiben kann.
Kein Baumeister wird es unterlassen, die Fachliteratur zu studieren und Vorversuche anzustellen; zuletzt wendet er sich dann wohl noch an den Mann der exakten Wissenschaft mit der Bitte um eine Berechnung. Als ob eine Berechnung der akustischen Werte eines Raums unter mehr als ganz allgemeinen Gesichtspunkten überhaupt möglich wäre. Merkwürdig! Es kommen keine Gesetze in Frage, die uns nicht durch und durch bekannt wären, und die sich nicht in zeichnerischer oder mathematischer Darstellung auf den Gegenstand anwenden ließen; nichts, aber auch gar nichts ist prinzipiell von Schwierigkeit, nur die Vielgestaltigkeit der Aufgabe, sie allein läßt alle Mühe umsonst erscheinen.
Man vertiefe sich doch einmal in die Verhältnisse.
In einem geschlossenen Raum spricht ja niemals der Redner allein; alle seine akustischen Spiegelbilder reden tapfer mit, und sie bilden sich überall aus an der Rückwand, den Seitenwänden, am Boden, an der Decke; eine Wand wirft die Schallwellen der andern zu, und im Grunde mag es akustisch hierbei ganz so aussehen wie optisch in jenen bekannten Riesenkaleidoskopen, deren Spiegelwände aus wenigen Personen eine große Volksmenge machen.
Nur ein gewaltiger und wesentlicher Unterschied ist dabei. Infolge der relativ langsamen Ausbreitung der Schallbewegung erscheinen die akustischen Spiegelbilder nicht gleichzeitig, sondern nacheinander, und so kommt dabei leider kein Unisono heraus, sondern ein nachhallendes, verwirrendes Durcheinanderrufen, als ob die Worte von einem ganzen Auditorium mehr oder minder laut und mehr oder minder verspätet, je nach der Entfernung des einzelnen vom Redner, wiederholt würden. Wenn dieser schließlich immer auch der lauteste von allen bleibt, so wird das, was er spricht, doch verwischt, unklar; die Silbe fällt ihren eigenen früher geborenen und nach der soundsovielten Reflexion zurückkehrenden Schwestern zum Opfer. Schnellläufiges musikalisches Figurenwerk ist dann vollends verloren.
Wo aber Reflexionen vorhanden sind, da begegnen sich auch Wellenzüge, und in unserm Raum entsteht ein krauses Netzwerk schallstarker und schallschwacher Duanscher Zonen. Wie kompliziert wird doch nun unser scheinbar so einfaches Problem! Die Zonen lassen sich leicht entdecken, wenigstens bei längeren Wellen.
Durchwandert man den Raum, während beispielsweise eine tiefere Orgelpfeife ertönt, so nimm man sie sehr deutliche an einem An- und Abschwellen des Tones wahr. Je höher der Ton ist desto enger liegen die Zonen beieinander. Nun denke man sich einmal, daß nicht ein Ton mit ganz bestimmter Wellenlänge, sondern eine ganze Tonreihe oder mehrere Töne zugleich, daß die menschliche Stimme mit ihrem Auf und Nieder, ihrem Klangreiz und Reichtum an Obertönen den Raum füllt. Dann geht es wahrlich kraus genug in der Luft zu. Die Interferenzzonen schscheinen im hastigen Spiel hin- und herzuspringen, sie verstärken im Konzert der Töne bald diesen Ton, löschen bald jenen; und dazu das Nachhallen, dieses lästige Mitschwatzen und Nachäffen der Spiegelbilder, dieser wahrhaftige Höllenspuk unsichtbarer Geister – ja, verehrter Leser, das ist unser akustisches Bild, und so sieht es auch in Träumen des armen Baumeisters aus, dessen stolze Hoffnungen, dessen mühselige Arbeit an den Laienmund schnell und erbarmungslos ausgesprochenen Worten zunichte wird: schlechte Akustik.
Man hat geglaubt, die Verhältnisse vorher im kleinen, an Modellen studieren zu können. Das ist von Vorteil gewesen, wenn auch von bedingtem, falls es nämlich gelang, die Schallwellen in gleichem Maßstab zu verjüngen. Im großen scheitert doch meist alle Kunst an den mannigfachen Anforderungen, denen der Raum genügen soll. Am einfachsten wäre es ja, die Reflexion überhaupt zu beseitigen und damit allen Komplikationen radikal aus dem Weg zu gehen. Dann müßte man Wände schaffen, denen eine absolute Schalldurchlässigkeit oder Absorptionsfähigkeit zukäme. So unmöglich wäre das nicht; Zeltwände beispielsweise reflektieren fast gar nicht, weil sie fast alles hindurchlassen, und niemand wird sich zwischen ihnen über die unerbetene Mitwirkung des Nachhalls zu beklagen haben. Aber zufrieden wäre er trotzdem nicht und noch weniger der Redner, denn der würde gar bald merken, wie wenig seine Stimme getragen wird, und wie sehr er sich anstrengen muß, um den Raum zu füllen. Seine Worte sind zwar deutlich zu vernehmen, klar, aber auch matt; jede Silbe wird hörbar, wenn der Redner über ein ausreichendes Organ verfügt, aber alles klingt trotzdem dünn, kraftlos und entbehrt des musikalischen Reizes. Man hört wohl geschliffene Passagen, Läufe von großer Präzision, aber sie klingen trocken; es fehlt ihnen, wie gesagt, die Fülle und in einem kurzen, die Schwingungen einen Moment fortsetzenden Nachhall gleichsam das verständig gebrauchte Pedal. Durch Zulassung von Zurückwerfungen an den Wänden wird zwar die Intensität des Schalls für den Hörer erhöht wie die Gesamthelligkeit innerhalb eines Raums durch Spiegelwände, aber Klangfülle und Klangsauberkeit sind eben leider Dinge, die, bei großen Abmessungen wenigstens, einander in den Weg treten. Das richtige Maß der Reflexion zu treffen, sie an Stellen zu verlegen, von denen aus man – ohne grobe nachhallende Störung – eine wirkliche Unterstützung des Redners erwarten kann, darin eben liegt die Hauptschwierigkeit.
Wie das Problem im besonderen zu lösen ist, kann nicht einmal angedeutet werden. Versuche zur Bestimmung der Absorptions · und Reflektionsfähigkeit von Wänden sind im Gang, aber noch nicht abgeschlossen und es dürfte noch eine geraume Zeit vergehen, bis man über die Durchlässigkeit bezüglich Isolationsfähigkeit von Baumaterialien genügend unterrichtet ist. Bis dahin können nur ganz allgemeine Gesichtspunkte in Frage kommen. Gelingt es der Baukunst, in der Nähe der Schallquelle zur Unterstützung der Lautstärke reflektierende Flächen von zweckmäßiger Formung anzuordnen und in größerer Entfernung störende Reflexe nach Möglichkeit zu beseitigen – etwa durch eine seitliche Ablenkung, Rauhputz, durchlässiges Material und so fort – so hat sie alles getan, was sie nach dem Stand der Wissenschaft für eine gute Akustik tun konnte. Alles übrige liegt einstweilen in der Hand des launischen Zufalls.
Dieser Artikel erschien zuerst im Jahr 1905 in Die Woche. Das Bild ist ein Beispielbild von mohamed Hassan auf Pixabay