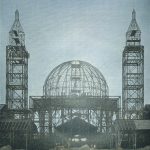Die Nummer vom 15. Juni 1894 der „Revue illustrée“, einer der angesehensten illustrirten französischen Zeitschriften, in deren Spalten die ersten Schriftsteller Frankreichs zu finden sind und die unter den illustrirten belletristischen Zeitschriften Europa’s mit an erster Stelle steht, veröffentlicht von Adolphe Brisson einen Bericht über eine Vergnügungsreise nach Berlin, der auf den ersten Blick durch die vortreffliche Wahl und Darstellung der Illustrationen, die sich in der überwiegenden Mehrzahl auf die Bau- und Kunstdenkmäler der deutschen Kaiserstadt beziehen, gefangen nimmt.
Den Kopf des Artikels schmückt eine Darstellung der Kaiser Wilhelmstrasse, von der Kaiser Wilhelm-Brücke aus gesehen; ihr folgt eine Ansicht der Börse mit der alten Friedrichsbrücke; das Opernhaus bildet den Gegenstand einer dritten Abbildung, eine vierte zeigt das Brandenburger Thor von der Innenseite, eine weitere das Schauspielhaus, wieder eine andere die Strasse „Unter den Linden“, es folgen dann Darstellungen des Denkmals Friedrichs des Grossen, der National-Gallerie, des alten Museums, des Schlosses von Sanssouci mit der Windmühle und der Bildergallerie, des Belle-Alliance-Platzes, der Stadtbahn am Alexanderplatz, des Passage-Einganges von der Friedrichstrasse, des kgl. Schlosses vom Lustgarten und von der Spree, des Reichstags-Gebäudes von der Spree aus gesehen und des neuen Palais in Potsdam. Neben den Baudenkmälern hat der Reiseschilderer nicht versäumt, einen Begriff von der Qualität des Inhaltes der königlichen Museen zu geben, indem er die Amme von Franz Hals, den jungen Kaufmann mit den Nelken von Hans Holbein; das Porträt des General Borro von Velasquez, die Frau mit der Wiege des Pieter de Hoogh und ein Fragment der Pergamonreliefs wiedergiebt. Beim Anblick dieser Abbildungen kann man sich schwer dem Eindruck verschliessen, dass durch sie ein gewisser beabsichtigter freundlicher und wohlwollender Zug geht. Dieser Eindruck wird verstärkt, wenn man den unmittelbar folgenden Artikel betrachtet, der in der gleichen freundlichen Weise von „Guillaume II intime“ handelt, und er wird zur Thatsache, wenn man dem Text der Reiseschilderung näher tritt. Gewarnt wurde unser Reisender vor Berlin; „gehen Sie nicht nach Berlin, es ist die langweiligste Stadt der Welt“. Die Warnung war unzutreffend, denn „diese 8 Tage sind schnell vergangen. Sie haben uns eine Menge neuer Eindrücke und gar manche Ueberraschungen gebracht.“
Dies ist ein historischer Text, welcher nicht geändert wurde, um seine Authentizität nicht zu gefährden. Bitte beachten Sie, dass z. B. technische, wissenschaftliche oder juristische Aussagen überholt sein können. Farbige Bilder sind i. d. R. Beispielbilder oder nachcolorierte Bilder, welche ursprünglich in schwarz/weiß vorlagen. Bei diesen Bildern kann nicht von einer historisch korrekten Farbechtheit ausgegangen werden. Darüber hinaus gibt der Artikel die Sprache seiner Zeit wieder, unabhängig davon, ob diese heute als politisch oder inhaltlich korrekt eingestuft würde. Lokalgeschichte.de gibt die Texte (zu denen i. d. R. auch die Bildunterschriften gehören) unverändert wieder. Das bedeutet jedoch nicht, dass die darin erklärten Aussagen oder Ausdruckweisen von Lokalgeschichte.de inhaltlich geteilt werden.
Die Reisobeschreibung enthält geistreiche Ausblicke auf die Kunst. Auf der Hinreise nach Berlin füllt den Reisenden der neue Bahnhof in Köln auf, „Der Bahnhof ist kolossal und mit einem entschiedenen Geschmack (goút violant) geschmückt, halb Kathedrale, halb Welt-Ausstellungspalast, Unter seinen majestätischen Wölbungen verkehrt ruhiges Volk… „ Die Landschaft ab Köln ist ein recht trauriger Theil von Deutschland, „Eine dürftige Vegetation, bedeckter Himmel, schmutzige Wege, schwarze Erde…. Was noch am anmuthigsten wirkt, das sind die Häuser mit den schneeweissen Mauern, von Fachwerk getragen und mit hohen Dächern bedeckt. Sie gleichen von weitem dem Nürnberger Spielzeug, das die Hand eines Riesen in die Ebene gestreut hat.“ Berlin! Da liegt die grosse Stadt, Strassen folgen Strassen, die an den Eeken von anderen nicht weniger langen und geometrischen Strassen durchschnitten werden, Trotz dem Regen fallen den Reisenden Granitfassaden, monumentale Portale und schwere, mit Bildhauerarbeiten geschmückte Balkons auf. Der Thiergarten erinnert an das Bois de Boulogne von Paris; er wird von den Linden durch das Brandenburger Thor „à trois arches“ getrennt, das im übrigen von „sehr dekorativem Anblick“ ist. Am Ende der Linden stehen zwei Museen: die National-Gallerie, in welche die Berliner ganz vernarrt sind, und die moderne Gemälde enthält, und das alte Museum, das sie kaum beachten. Die National-Gallerie ist schrecklich. Mit Ausnahme des grossen Walzwerkes von Menzel und zwei oder drei Schlachten-Szenen verdient der Rest kaum genannt zu werden.“ „Es ist eine spasshafte Sammlung von gemalten Anekdoten.
Tyroler Jäger, die vor zarten Schweizerinnen auf der Guitarre spielen, der erste Kuss, das Lächeln eines schlafenden Kindes, Frühlingsidylle – alle die Gemeinplätze einer falschen Poesie.“ Gewiss ist das Urtheil scharf, zu scharf, und berücksichtigt ausser werthvollen und guten Erwerbungen zu wenig die unglückseligen Vermächtnisse, die der Schrecken jeder Museums-Verwaltung sind und gerade auf dem Gebiete der modernen Malerei eine besonders erschreckende Gestalt annehmen. Aber wer von den Einsichtigen hätte nicht gewünscht, dass bei den Erwerbungen für die National-Gallerie strengere und grössere Gesichtspunkte walteten, wer hätte nicht gewünscht, dass sie vor allem von einem überlegenen, über den Parteien stehenden Standpunkte aus getroffen werden?
Das alte Museum jedoch, „in das Niemand geht“, enthält Meisterwerke ersten Ranges. Zunächst fallen den Reisenden die wundervollen Fragmente der pergamenischen Funde auf, unter anderen Stücken „ein Amazonentorso von einer solchen Geschmeidigkeit der Modellirung, von einer so lebendigen Grazie, von einer so stolzen Schönheit“, dass sie einen Photographen veranlasst haben, davon für die „Revue illustrèe“ eine Aufnahme zu machen. Im oberen Geschoss bemerken sie namentlich die Cranachs, die Quentin Massys, die Van Eyck, 5 oder 6 mittelmässige Rembrandt, dagegen einen herrlichen Rubens, die heilige Cäcilie, einen köstlichen (adorable) Pieter de Hoogh („Oh! Dieser Sonnenstrahl, welcher durch die Thürspalte fällt und den Körper des Kindes in Licht hüllt! … Welche Stille in dieser holländischen Wohnung!“), einen Velasquez in grossen Bewegungen, die berühmte Amme von Franz Hals, ein ausdrucksvolles und lebendiges Meisterwerk, das Konzert von Terburg, „ein wunderbares Kleinod an das noch keine deutsche Zeitschrift gedacht hat, es zu veröffentlichen und von dem eine Photographie nicht zu finden ist“; und „endlich das Porträt von Holbein, eines der schönsten Porträts der Welt“. – Man sieht, unser Franzose hat Geschmack. Den Tag beschlossen die Besucher Berlins im Lessing-Theater, sie sahen Madame Sans-Géne. Das Lessing-Theater bewundern sie als ein modernes und sehr bequemes Etablissement. „qui fait la fortune de son directeur“. Die Sitze sind breit, die Sitzreihen genügend weit von einander entfernt, so dass das Publikum verkehren kann, ohne sich die Füsse zu zertreten. .
Die Reisenden gehen auch ins Opernhaus; man giebt Rheingold. Das Opernhaus ist ein altes Bauwerk, dessen Inneres wiederhergestellt und mit neuen hellen Holzarbeiten versehen ist, Der Zuschauerraum ist länglich, er erinnert, auch in anderer Beziehung, an den Saal des Conservatoriums in Paris.
Der Dienstag führt die französischen Gäste nach Potsdam.
Tausend Erinnerungen, bei Voltaire angefangen, ziehen sie dahin, Sie brennen danach, das Schloss Sanssouci zu sehen. Die historische Mühle, finden sie, gleicht allen Mühlen, das Schloss aber ist „exquis“, „ein von den Grazien geformtes Kleinod. Der Ehrenhof, eingeschlossen von einer leichten Kolonnade, ist ein Muster von leichter Formengebung, und die entgegengesetzte Fassade, die den Park beherrscht und aus dichtem Grün aufsteigt, ist mit nicht weniger „Zartheit entworfen“. Sie bewundern das Innere, vor allem die Bibliothek, ein köstlicher Raum, mit geschnitzten Möbeln ausgestattet, ein wahrer Ort der Zurückgezogenheit für einen königlichen Poeten und philosophischen „Millionär.“ Dann gelangen sie in das Zimmer Voltaire’s, an dessen Mauern verschiedene Darstellungen in relief, lebhaft colorirt, sich befinden: ein Papagei, ein Affe, ein Eichhörnchen, ein Pfau, ein Storch, ein Fuchs. Der führende Cicerone setzt ihnen, „indem er die Augen zusammenkneift und den Mund bis hinter die Ohren aufreisst“, auseinander, dass Voltaire allen diesen Thieren geglichen habe, „Pauvre Voltaire!…. Ayez done du génie, pour étre traité de perroquet, cent ans aprés votre mort, par un sergeant de l’armèe prussienne!“ Das neue Palais ist ein düsteres, aber imposantes Gebäude, hinein kommen sie nicht. –
Sie kehren nach Berlin zurück, Einer ihrer weiteren Besuche gilt dem Theater „Unter den Linden.“ Man hat es ihnen gerühmt. In der That, das Theater ist entzückend. Der Zuschauerraum ist ein Juwel, das mit feinen Stuckornamenten im Charaktor Louis XV. geziert ist. Im ersten Rang entfaltet sich ein breites und helles Promenoir. In der Höhe der ersten Gallerie sind kleine, elegant möblirte Salons angelegt. Ein nach dieser Form angelegtes Theater fehlt uns in Paris. „Ach, wenn unsere Architekten nicht so faul wären! Wenn sie geruhten, die Welt zu bereisen und neue Gedanken zu suchen!“ Soweit die Reisebeschreibung.
Es kann und darf hier nicht unsere Aufgabe sein, Politik zu machen. Das verbietet uns aber nicht, anzuerkennen, dass sich die Anzeichen mehren, dass in Frankreich die Zeit des Hasses beginnt in das Stadium der Würdigung und des Verständnisses überzugehen. „Es wäre so wenig erfordert, damit zwei Völker, die sich hassen, sich plötzlich umarmen würden“, schreibt Alexander Dumas fils einmal in einem Briefe vom Jahre 1892. Aber das wäre nicht einmal das Ziel unserer kühnsten Wünsche. Ihnen würde schon entsprochen, wenn man zu der Erkenntniss käme, dass alles nur vergänglich, alles nur hinfälliges Bauwerk ist, was die Staatskunst aufrichtet und dass es nur der unendliche Strom der gesitteten Kultur und Kunst ist, der die Völker eint und sie zu dem idealen Zustande der kosmopolitischen Völkereinigkeit führen kann, dem schon Herder das Wort geredet. Nur diese vermag die Kunst des Lebens und das Leben in der Kunst zu der Vollendung zu führen, die die Menschheit sich wünschen darf und wünschen muss, Sie wird aber nicht eintreten. Das allegorische Basrelief des David d’Angers: „La France et l’Allemagne unies par la liberté“ wäre heute auch in dieser Beziehung nicht mehr möglich, und als in diesen bewegten Tagen das Wort gesprochen wurde, Carnot habe sterbend die Welteinigkeit als Erbe hinterlassen, fügte der „Figaro“ hinzu: „Welch’ schöner Traum.“ Leider nur ein Traum.
Dieser Artikel von Albert Hofmann erschien zuerst 1894 in der Deutschen Bauzeitung.