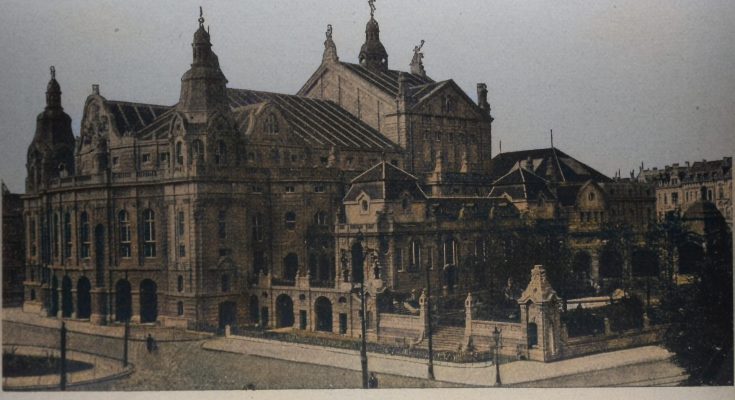Heumarkt und Neumarkt
Im Allgemeinen hat der anstoßende Heumarkt den Charakter der Wohlhäbigkeit, einzelne Prachtgiebel neben bauschönen aber verfallenen alten Facaden aufzuweisen, und seit 1730 in seiner Mitte das Börsengebäude. Eine altherkömmliche Staffage des Heumarktes sind am Nordende die Bänke der „Altruyscher“ oder Schuhflicker, aber nur mit altem Leder, von denen man uns erzählte, sie hätten die Stadt einmal vor einem feindlichen Ueberfalle gerettet, und daher genössen sie dieses Rechtes.
Ein Bürgermeister, Johann Balthasar von Mülheim, schuf der Stadt 1740 den jetzigen Neumarkt, vordem ein verödeter Platz, in dessen Mitte eine Lache, eine Pferdeschwemme, neben der eine Windmühle, die erste im fünfzehnten Jahrhundert in der Stadt errichtete. Der Platz war ehedem von den Bürgern zum Vogelschießen benutzt worden.
Dies ist ein historischer Text, welcher nicht geändert wurde, um seine Authentizität nicht zu gefährden. Bitte beachten Sie, dass z. B. technische, wissenschaftliche oder juristische Aussagen überholt sein können. Farbige Bilder sind i. d. R. Beispielbilder oder nachcolorierte Bilder, welche ursprünglich in schwarz/weiß vorlagen. Bei diesen Bildern kann nicht von einer historisch korrekten Farbechtheit ausgegangen werden. Darüber hinaus gibt der Artikel die Sprache seiner Zeit wieder, unabhängig davon, ob diese heute als politisch oder inhaltlich korrekt eingestuft würde. Lokalgeschichte.de gibt die Texte (zu denen i. d. R. auch die Bildunterschriften gehören) unverändert wieder. Das bedeutet jedoch nicht, dass die darin erklärten Aussagen oder Ausdruckweisen von Lokalgeschichte.de inhaltlich geteilt werden.
Die südliche Seite des Neumarktes war mit neuen Häusern bebaut, auf der nördlichen Seite die jetzt niedergerissene Capelle St. Gertrud, dann die Stadt Prag, mit ihrem bauprächtigen Erker, jetzt die Richmodstraße, und das Haus der Familie von Haquenay, uns Kindern ein Ort des Unbegreiflichen, wo der Gott sei bei uns, wie man uns erzählte, seinen Sabbath hielt, denn dort haus’ten die Freimaurer. Dann auf der anderen Ecke, Caseusgasse, das Haus zur Papageien, in welchem die wiedererstandene Frau Richmod von der Aducht gewohnt hatte. Die Ecke des Platzes bildet hier der Blankenheimer-Hof, seit 1811 kaiserliche Tabaks-Manufactur, und daran stoßend das Arresthaus, die „Bleche Boz“, früher ein Clarissen-Nonnenkloster.
Dasselbe wurde als Domaine von dem Vater des Architekten Hittorff in Paris gekauft, später von dem Baumeister Butz zu seinem jetzigen Zwecke umgebaut, und daraus machte der kölner Volkswitz den Namen. Der Ankäufer, ein Klempner, führte den Spitznamen „Blechen Alexander“. Die Ostseite der Umgebung des Platzes bildet der Gymnicher-Hof, die Westseite an Aposteln stoßend, das Klöckerwäldchen, eine Baumpflanzung zu einsamen Spazirgängen, wo früher die Schaubühne errichtet war. Und hinter demselben der schauerliche Kirchhof von St. Aposteln, das Kloster des Stifts, eine idyllische Gänseweide.
Für uns Kinder war die Abbildung des Platzes mit dem riesigen Ochsen mit den plastischen, vergoldeten Hörnern, welche das Vorhaus des Heimann’schen Hauses, jetzt Mosler’s Conditorei schmückte, und aus der alten Goldschmiedzunft herrührte, ein wahres Kunstwunder.
Der Platz selbst kann uns mancherlei von den politischen Schicksalen der Stadt erzählen. Am 4. October 1794 sah er die ersten Franzosen, am 9. wurde der Freiheitsbaum auf demselben errichtet, und er hieß „Place de la République“, dann „Place des Victoires“ und trug eine Pyramide zur Verherrlichung der Siege Napoleon’s, dessen Rame „Place de l’Empereur“, auch, „Place d’armes“, der Neumarkt später führte, bis die Franzosen am 14. Januar 1814 von demselben aus abzogen.
Straßen im Innern
Wählen wir auch die Hauptader des Stadtverkehrs, die Hochstraße, von St. Paul die Fettenhenne entlang, an der Huhschmitt, unter Goldwagen vorbei, wo uns neben der Ecke der großen Budengasse aus dunkeln Taxusbüschen Sommer und Winter Tausende von Spatzen mit ihrem melodischen Gezwitscher erfreuen, gehen dann an den vier Winden entlang, unter Wappenstecker, an den Augustinern unter Pfannenschläger, wo von früh am Tage bis spät in den Abend das weittönende Gehämmer der Pfannenschmiede schallte: freundlich, geschäftig, lebendig ist das Bild der Straßenreihe keineswegs. Wir Knaben machten uns im Vorbeigehen den Spaß, die Schmiede zu fragen, wie viel Uhr es sei? und ließen uns durch die uns nachgeworfenen Hämmer nicht abschrecken, so oft als möglich den Schabernack zu wiederholen.
Der allgemeine Eindruck der engen, unregelmäßigen, von vielen verfallenen Häusern eingerahmten Straßen ist eben kein freundlicher. Selten verlief sich Jemand über den Bering der Altstadt hinaus, es sei denn zum Besuche einzelner Kirchen. Aber um so düsterer, um so trostloser, je mehr wir uns von den belebteren Stadttheilen entfernen, jedoch malerisch über alle Beschreibung. Welch‘ ein Wechsel der Bauformen, welche romantische Mannigfaltigkeit in der Färbung! jeder Giebel eine Maler-Studie.
Umgebung des von Zuydtwich’schen Hauses
Die bauschönen, romanischen, bis ins dreizehnte Jahrhundert hinaufreichenden Bogenfacaden aus Tuff, mit Säuleneinstellungen aus schwarzem Marmorschiefer, die Wohnungen der edlen kölnischen Geschlechter, jetzt Privathäuser, die Burgvesten ähnlichen Edelsitze und Höfe der benachbarten Abteien und adligen Familien mit ihren Zinnen, Erkern und schlanken Lugthürmen – jeder Bau ein Blatt Geschichte -, an welche sich einzelne vier- und fünfstöckige Treppengiebel des sechszehnten und siebenzehnten Jahrhunderts reihen, in deren Schatten wieder kleine, oft nur einstöckige, spitzgegiebelte, nicht selten zu zweien unter ein Dach gezwängte Häuschen gleichsam Schutz suchen, während selbst in den Hauptstraßen viele Häuser mit ihren Ueberbauten den Bewohnern Licht und Luft nehmen. Hohläugig, spukhaft blicken manche derselben in die engen, grasbewachsenen Straßen, auf die verödeten Plätze, die, mit Bäumen staffirt, meist, wie manche außerhalb des eigentlichen Berings der Altstadt gelegenen Straßen in ihrem Verfalle malerische Brunnenhäuschen aufzuweisen haben, indem man in jenen Stadttheilen noch keine Pumpen kennt.
Manche Gebäude, über alle Beschreibung verkommen und verwittert, dienen den einzelnen, im gefälligen Mansarden-Style des achtzehnten Jahrhunderts erbauten Häusern, die wir Knaben als wahrhafte Paläste anstaunten, zu einer mehr als malerischen Folie. Und sind diese stattlichen Wohnungen einzelner Patricier und Bürgermeister-Familien, weniger Kaufherren, keine Paläste im Vergleich ihrer ärmlichen Umgebung? Die Worte fehlen mir, wollte ich, um nur ein Beispiel anzuführen, die damalige Umgebung des von Zuydtwick’schen Hofes, welchen der oben genannte Bürgermeister von Mülheim für sich baute, des jetzigen erzbischöflichen Palastes schildern, die alle Gräuel des Verfalles aufzuweisen hatte.
Napoleon I. in Köln
Als Napoleon I. bei seiner letzten Anwesenheit in Köln im von Zuydtwick’schen Hofe abgestiegen, hatte man die mehr als trostlose Nachbarschaft mit Bäumen und Maien zu maskiren gesucht, und dem Hause gegenüber das Elend hinter mit allegorischen Figuren bemalten Theater-Versetzstücken, in denen man es damals stark that, versteckt. Bei dieser Gelegenheit hörte ich einen Bürger, vom Kaiser und seiner Gemahlin sprechend, sagen: „Hae es ald he, un Idt kutt disse Nommendag!“
Charakter der Häuser
Auf den meisten stattlichen Treppengiebeln, und selbst auf den niederen Spitzfronten, knarren die alten, rostigen Wetterfahnen, die „Wimpeln“. Drohend ragen unter den Giebelschlüssen die phantastischen Greinköpfe in die Straße hinaus, zum Hinaufziehen von Lasten bestimmt, und auch wohl zum Aufhängen der geschlachteten Ochsen und Schweine benutzt. Geschäftig umflattern die heimlichen, für heilig gehaltenen Schwalben die langgewohnten Nester in den über vielen Thüren angebrachten Fratzenköpfen, welche die Sage bis ins eilfte Jahrhundert, in die Zeiten des Erzbischofes Anno I. versetzt, als Erinnerung an die Bürger, denen der streng zürnende Bischof, nach einer Empörung der Bürgerschaft, die Augen ausstechen ließ. Sie sind aber zur Aufnahme der Schrotbäume angebracht, denn die däftigen Bürger legen sich ihren Wein ein, sei es nun Propre ersi von ihren Weingütern, oder beim Producenten selbst gekaufter Ahrbleichart.
Jedes ordentliche Haus hat seinen Schrot, auch wohl eine besondere Schrotthür.
An Stangen befestigt, schaukeln sich noch hier und da, besonders in den Vorstädten, die uralten, eisernen Aushängeschilder, flattern die zum Trocknen ausgehängten Tücher, das wollene Garn der Blaufärber. Wie gemüthlich gießen bei der geringsten Regenschauer die mit reichem, phantastischen Laub- und Schnörkelwerk aus Blei verzierten, weit hinausstarrenden Dachrinnen ihre Wasserströme in die Straßen, während zu allen Tageszeiten die Küchencascaden, vulgo Spülsteine, in allen Höhen vom Boden ihre Brühe auf das Plafter plätschern, und zwar ganz schonungslos gegen die Vorübergehenden.
Die mit starken Eisengittern oder oft kunstvoll geschmiedeten Eisenkörben verwahrten Fenster der Erdgeschosse, ihre schweren äußeren Holzblenden, die mit Eisen oder doch mit dreiköpfigen Nägeln beschlagenen Thüren, mit ihren, von durchlöcherten Eisenplatten geschützten Lugschaltern, den schweren eisernen oder messingenen Kumpen zur Aufnahme der Hausschlüssel, geben manchen Häusern das düstere Ansehen von Gefängnissen, und uns einen eigenen Begriff von der früheren Sicherheit der Bürger.
Einen wahrhaft unheimlichen, spukhaften Eindruck machen auch viele der alten, schauerlich düsteren himmelhohen Giebel mit ihren halbverfallenen, an einem Angelhaken hängenden Laden, ihren hohlen Fensteröffnungen, den kleinen grünen, runden, meist tauben Scheiben, die in allen Farben des Prisma’s spielen, und nicht selten in ihren papiernen Sternen, mit welchen sie zusammengeklebt, ein ganzes Firmament zeigen. Fast ein jedes dieser unheimlichen Häuser war der Schauplatz einer grauenvollen Sage.
Was erzählten sie uns Kindern nicht Alles, was wußten sie nicht zu erzählen? Selbst von den, in den mannigfaltigsten Gestalten geformten messingenen und eisernen Thürklopfern, wie Drachen, Löwen, Seeweibchen, Engel und Teufel, Schlangen, alte Männer und Frauen, in sonderbaren Trachten und sonstigen phantastischen Ungethümen gestaltet, erzählt sich die Phantasie die buntesten Märlein. Die schauerlichsten Sagen und Spukgeschichten machen der lieben Jugend viele Plätze und Häuser unheimlich, so daß sich ein Knabe im Tage nur mit Grausen, aber nicht leicht bei Nacht und Unzeit in ihre Nähe wagte.
Düster ist das Aussehen vieler Straßen auch dadurch, daß die Mehrzahl der Häuser noch den natürlichen Ton des Tuffs, der Ziegel und des Mörtels haben in allen nur möglichen Nüancen der so malerischen Färbung der Zeit, zerfressen und zerbröckelt.
In den entlegenen Stadttheilen putzt der Tünchquast zur Kirchweihzeit die kleinen Giebel jährlich auf. Oelanstrich der Giebel war eine solche Seltenheit, daß ich mich noch erinnere von einem Bürger, der seinen Giebel in Oel anstreichen ließ, sagen gehört zu haben, er müsse nicht wissen, wie er’s aufkriegen sollte. Als an Lyskirchen ein Bürger sein Haus hatte anstreichen lassen, und die wüste Schuljugend ihm die Marktafel des Wasserstandes von 1784 beschmutzte, ließ er dieselbe so hoch am Giebel anbringen, daß die Knaben sie nicht mehr erreichen konnten.
Noch lebt der furchtbare Eisgang und die dadurch entstandene Ueberschwemmung des Jahres 1784 in der Erinnerung mancher Kölner. Das Wasser erreichte die unglaubliche Höhe von 39 1/2 Fuß, als am 28. Februar, Vormittags, die an einzelnen Stellen 14 bis 16 Fuß dicke Eisdecke durchbrach. Eine Menge Häuser in der Stadt wurden durch die Fluten vernichtet, 2700 mehr oder minder beschädigt und an der Kehlmauer verschiedene Rondelle, Thürme und Mauerstrecken von der Gewalt des Wassers und Eises fortgerissen. So weit die historischen Nachrichten gehen, wurde die Stadt zu verschiedenen Malen von ungeheuren Ueberschwemmungen heimgesucht.
Am 4. Januar 1374 stieg der Rhein so furchtbar, daß man, wie die Chronik berichtet, über die Stadtmauer, die aber nicht so hoch, wie jetzt, fahren konnte, und zwar bis zum Quattermarkte und zu den Treppen an Mariengraden. Das Wasser verlief sich erst nach Ostern. Im Jahre 1432 wurde die Stadt von sechs Eisfahrten heimgesucht, die viele Schiffe zerstörten und eine Menge Häuser an der Rheinseite vernichteten. Der Rhein brach 1496 bei Wesselingen, Godorf und Rodenkirchen durch, und überschwemmte das Land bis Melaten. Alle Dörfer und Ortschaften standen Wochen lang unter Wasser, und Köln litt unsäglichen Schaden. Drei Eisgänge richteten 1670 bedeutenden Schaden an, und 1740 brach der Rhein bei einer Höhe von 28 Fuß unterhalb Cunibert durch, und setzte die ganze Niederung unter Wasser, weßhalb denn vom Jahre 1741 bis 1745 der Nieler Damm erbaut wurde. Eine ausführliche Schilderung der furchtbaren Katastrophe von 1784 findet man im 4. Bande, Seite 73 fflg. von Dr. von Mering’s Werk: „Zur Geschichte der Stadt Koln am Rhein.“
Umbauten
Hier und da wurden Spitzgiebel gekappt und mit flachem Sims versehen; uns Knaben Wunderwerke der Baukunst. An verschiedenen Enden der Stadt baute man einzelne neue Häuser, aber als Seltenheit; und unter diesen ward als ein Non plus ultra bewundert das Haus in der Schilderergasse auf der Ecke der Kreuzgasse, dessen Facade der jetzige Präsident der pariser Académie des Beaux-Arts, der Kölner Hittorff, als Steinmetz-Lehrling beim Baumeister Leisten, entworfen hatte. Sonst begnügte man sich damit, hier und da einzelnen Häusern einen ganz neuen Giebel zu geben mit größeren Fenstern und der nüchternsten Formen-Monotonie, ließ aber die alten Dispositionen des Inneren ungestört mit allen Kämmerchen und Hängstübchen, man baute bloß, wie der Kölner sagte, – einen Flabes.
Flabes, die Maske, das Gesicht. Süddeutsch: die Flabbe, das Hängemaul, Geifermaul; das italienische fiaba, die Lüge.
Dies ist ein Auschnitt aus dem Buch Köln 1812, mehr Infos dazu hier. Das Inhaltsverzeichnis zum Buch, in dem die online verfügbaren Abschnitte verlinkt sind, ist hier zu finden.